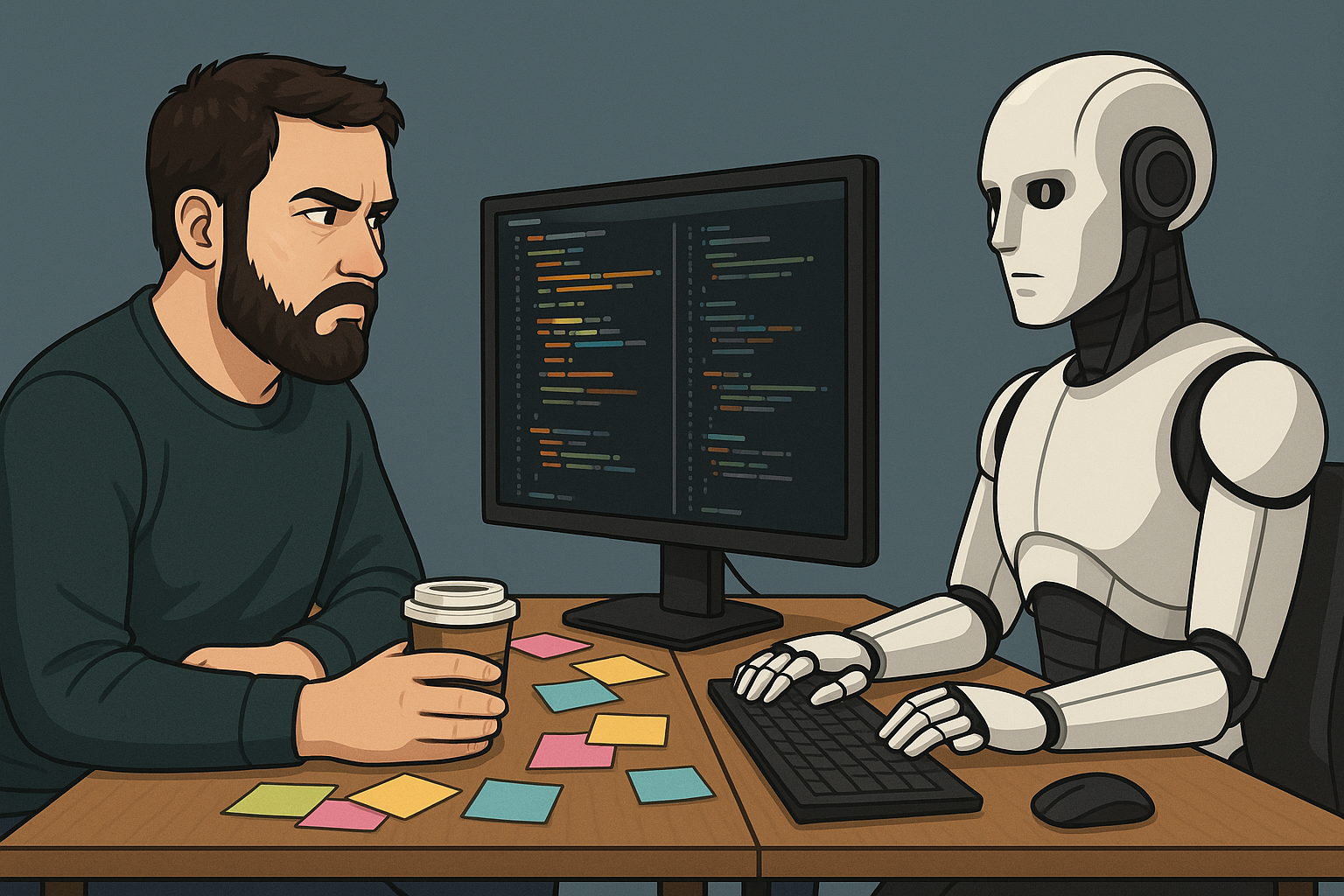
AI Coding Journal - Prolog
Veröffentlicht am 27. September 2025 - ⏱️ Ca. (wird berechnet) min. Lesezeit
AI Coding zwischen Hype und Realität
Kaum ein anderes Thema hat in den letzten Jahren so viele Diskussionen ausgelöst wie das Entwickeln mit KI. Seit die ersten Modelle Code generieren, überschlagen sich die Schlagzeilen: „Entwickler werden hundertmal produktiver“, „Bald schreibt niemand mehr selbst Code“, „Software entsteht in Minuten“. Wer sich durch Konferenzen, Blogartikel und LinkedIn-Posts klickt, hat schnell das Gefühl: Wer jetzt nicht sofort aufspringt, droht abgehängt zu werden.
Je lauter diese Versprechen werden, desto lauter wird die Dissonanz im Hintergrund: Man hört keine Entwicklerstimmen. Keine Entwickler, die ihre Erfahrungen ernsthaft und nachvollziehbar dokumentieren. Was wir lesen, basiert fast immer auf Hörensagen: Auf Marketing-Slides, auf Sekundärquellen, auf Tool-Ankündigungen und von KI Experten, die wie Scrum Master aus dem Boden schiessen. Wenn überhaupt, dann berichten einzelne Nutzer über kurze Aha-Momente – selten aber über eine kontinuierliche Praxis. Kaum jemand legt offen, wie sich KI im echten Projektalltag verhält, wie sich die Ergebnisse in den Code einfügen, welche Fehler entstehen und wie viel Nacharbeit nötig ist.
Code als Fundament – warum Clean Code zählt
Genau hier beginnt mein Unbehagen. Als Entwickler kann man nicht ernsthaft über AI Coding sprechen, ohne über den Code selbst zu reden. Code ist das Fundament jeder Software – er ist nicht Beiwerk, sondern die einzige vollständige, präzise Beschreibung dessen, was ein System wirklich tut. Alles andere – Architekturdokumente, UML-Diagramme, Tickets – sind Abstraktionen oder Annäherungen. Nur im Code selbst ist jede Entscheidung, jede Abhängigkeit und jeder Sonderfall lückenlos festgehalten.
Genau deshalb ist Clean Code so entscheidend: Nur klar strukturierter, gut lesbarer und wartbarer Code erlaubt es, Software über Jahre hinweg zu verstehen, zu erweitern und zuverlässig zu betreiben. Schmutziger, undurchsichtiger Code mag kurzfristig funktionieren, doch er wird zum Schuldenberg, der Projekte lähmt. Clean Code ist die Bedingung dafür, dass Software funktioniert und lebt statt verfällt. In den meisten Artikeln über AI Coding wird der Code aber entweder gar nicht gezeigt oder bestenfalls als dekorativer Schnipsel angefügt.
Vibe Coding oder ernsthaftes Engineering?
Stattdessen dominiert eine andere Haltung: sogenanntes „Vibe Coding“. Ein paar Zeilen in den Prompt, schnelle Ergebnisse, beeindruckende Demos und das Gefühl, plötzlich unendliche Produktivität zu entfalten. Dieser Stil ist für ernsthafte Softwareentwicklung nicht tragfähig. Er erzeugt Code, den niemand reflektiert, den niemand in Architekturprinzipien einbettet, den niemand auf Wartbarkeit prüft. Wer sich auf Vibe Coding verlässt, baut Spielzeug, keine Produkte. Sonst wäre die Software Landschaft bereits komplett umgekrempelt und überflutet von neuen Produkten.
Mich selbst hat das Thema aufgrund der massiven Überhöhung lange eher genervt als begeistert. Die ständigen Behauptungen, dass man ohne KI zurückbleibt, haben mehr falschen Druck erzeugt als Neugier. Gleichzeitig konnte und wollte ich es dennoch nicht ganz ausblenden. Zu spannend waren damals meine ersten Schritte mit ChatGPT und die Erkenntnisse, die es mit sich brachte. Es gibt Stellen, an denen die Werkzeuge helfen. Beim Beschleunigen von Routinen, bei kleinen Aufgaben - wie Skripten oder statischen Homepages. Vielleicht sogar beim Aufzeigen alternativer Lösungswege und als Sparringpartner. Nur: Das lässt sich nicht aus Präsentationen ablesen, man muss es in der eigenen Praxis erfahren.
Das Ziel dieses Journals
Also starte ich nun dieses Journal. Ich möchte mit gutem Beispiel vorangehen und meine Erfahrungen dokumentieren. Kein Playbook mit tausend Versprechen verkaufen. Kein Hörensagen. Nur ein Entwickler und Softwarearchitekt mit seinen Erfahrungen zum Thema Coding mit KI. Und ganz wichtig: Mit Blick auf den Code. Mich interessieren keine Demos. Mich interessiert: Wie gut unterstützt mich KI in meinem Job.
Meine - zugegeben hochgradig provokante - Ausgangsthese: Ein guter Entwickler, der ganz auf AI Coding verzichtet, verliert nichts. Er bleibt fokussiert, ungestört, und liefert mit stabilen Methoden solide Ergebnisse. Aber: Wer die Werkzeuge reflektiert einsetzt, kann punktuell profitieren. Er wird nicht plötzlich auf magische Weise hundertmal schneller, wird aber Routinearbeit reduzieren, sich selbst challengen und verbessern.
Mal sehen, ob ich nach dieser Serie immer noch so denke, oder nach einigen Teilen die Paywall aufziehe und als selbst ernannter KI-Experte Linkedin mit meinem Heilsversprechen unsicher mache. Einstweilen möchte ich aber vor allem zwei Dinge erreichen:
Erstens: eine Dokumentation, die andere Entwickler nutzen können, wenn sie sich nicht durch den Strom an Sekundärquellen wühlen wollen.
Zweitens: einen konstruktiven Beitrag zur Debatte, die viel zu lange von Übertreibungen geprägt war. AI Coding ist kein Wundermittel, aber auch kein Schreckgespenst. Es ist ein Werkzeug.
Der Fahrplan für die nächsten Artikel
Dieses Journal kommt nicht sofort mit den neuesten Tool-Experimenten, sondern beginnt mit einem Rückblick. In den letzten zwei bis drei Jahren habe ich intensiv mit AI Coding gearbeitet. Vieles davon war spannend, manches ernüchternd, einiges wirklich hilfreich.
Bevor ich aktuelle Themen wie Claude Flow oder den Einsatz von ADR-Dateien in Greenfield-Projekten aufgreife, möchte ich diese Erfahrungen systematisch aufrollen. Nicht als Historie um der Historie willen, sondern um den Status quo sichtbar zu machen: Wo trägt AI Coding, wo scheitert es und welche Muster haben sich wiederholt gezeigt?
Die ersten Teile dieses Journals sind eine Aufarbeitung meiner bisherigen Praxis. Danach folgen neue Experimente und Analysen, mit derselben kritischen Brille und mit Blick auf den Code.
Alles, was ich hier schildere, sind Erfahrungen aus meinen eigenen Anforderungen und Experimenten und geprägt durch meine Rolle als Softwarearchitekt und Consultant. Ich arbeite oft mit Legacy-Code und komplexen Projekten im Hintergrund. Meine Sicht ist daher nicht allumfassend, sondern die eines Praktikers, der kritisch prüft, was im echten Projektalltag trägt und was nicht.
Ich lade alle ein, diese Serie zu begleiten, mitzudenken, Feedback zu geben. Denn nur wenn Entwickler ihre Erfahrungen offen teilen, entsteht ein realistisches Bild. Bis dahin gilt: Wer ernsthaft über AI Coding spricht, muss auch über den Code sprechen. Alles andere bleibt Gerede.